folgt: 5.2 Flockenbildung und Sinkgeschwindigkeit
hinauf: 5. Eigenschaften kohäsiver Sedimente
vorher: 5. Eigenschaften kohäsiver Sedimente
5.1 Material und Partikelgröße
Zur Klassifizierung der Partikelgrößen von Sedimenten wird von
[30] und [75] die UDDEN-WENTWORTH-Skala verwendet.
Diese basiert auf dem Logarithmus zur Basis 2 des Partikeldurchmessers in mm.
Die UDDEN-WENTWORTH-Skala definiert die Grenze zwischen
Kies und Sand bei  , die Grenze zwischen Sand und Schluff bei
, die Grenze zwischen Sand und Schluff bei
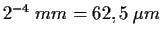 und die Grenze zwischen Schluff und Ton bei
und die Grenze zwischen Schluff und Ton bei
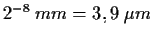 .
.
Der Partikeldurchmesser von Sand lässt sich durch
Siebung bestimmen. Enthält das Sediment Anteile von Schluff und Ton, muss nass
gesiebt werden [30]. Natürliche Sedimentpartikel sind nicht
kugelförmig. Werden Durchmesser mittels Siebung ermittelt, bezieht sich die
Angabe auf die Siebweite. Es ist möglich, wenn auch sehr aufwendig, die
Partikelgrößen von Schluff und Ton unter dem Mikroskop zu bestimmen.
In der Praxis wird zur Ermittlung der Partikelgrößen die
Sinkgeschwindigkeit im Wasser bestimmt, d. h. die Angabe von
Partikeldurchmessern bezieht sich auf eine Kugel, die bei gleicher Dichte
dieselbe Sinkgeschwindigkeit im Wasser erreichen würde. Wie in Abschnitt
5.2 noch näher erläutert wird, neigen kohäsive Sedimente dazu, Flocken
zu bilden, deren Sinkgeschwindigkeit sich von der des einzelnen Partikels stark
unterscheidet. Bei der Korngrößenbestimmung werden chemische Zusätze
verwendet, die die Flockung unterdrücken.
Natürlich vorkommende Sedimente sind in aller Regel Mischungen aus Partikeln
unterschiedlicher Größen. VAN RIJN[102] gibt an, dass
Sedimentgemische, die mehr als  Ton enthalten, kohäsive
Eigenschaften aufweisen.
Ton enthalten, kohäsive
Eigenschaften aufweisen.
Die Eigenschaft der Kohäsion erlangen die in [30] [102]
genannten Tonmineralien Kaolinit, Montmorillonit, Illit und Chlorit
durch die elektrostatische Ladung auf der
Oberfläche der plättchenförmigen Partikel.
Die Partikelkanten tragen positive und die Partikelflächen negative
Ladung. Geraten zwei Partikel in geeigneter Orientierung nahe genug zusammen,
bleiben sie aneinander haften. Die ebenfalls elektrisch geladenen Salzionen
fördern den Flockungsprozess.
Es existieren somit zwei Definitionen von Ton. Zum einen die mineralogische,
die Ton anhand der chemischen Zusammensetzung definiert, und die
Definition anhand der Partikelgröße, die Ton als Partikel definiert, die
langsamer sinken als Kugeln gleicher Dichte mit Durchmessern unter
 . Diesem Widerspruch ist PULS [97] in seiner
Untersuchung von Schlick aus fünf verschiedenen Ästuaren nachgegangen und hat
festgestellt, dass die Untersuchung der Partikelgröße immer einen kleineren
Tonanteil ergibt, als die mineralogische Untersuchung.
. Diesem Widerspruch ist PULS [97] in seiner
Untersuchung von Schlick aus fünf verschiedenen Ästuaren nachgegangen und hat
festgestellt, dass die Untersuchung der Partikelgröße immer einen kleineren
Tonanteil ergibt, als die mineralogische Untersuchung.
KOLBE[61] hat Sedimentproben aus dem Weserästuar untersucht, die
an den bei Ebbe zugänglichen Wattflächen von 1975 bis 1994 entnommen wurden.
Drei Probennahmestellen liegen im Lune-Watt, das der von GRABEMANN
[39] ausgewerteten Messstelle im Belxer Bogen (Unterweser km
62,5) ungefähr gegenüberliegt. Siehe
Bild 3.
Der Tonanteil in diesen
Proben liegt bei  und schwankt mit den Jahren zwischen
und schwankt mit den Jahren zwischen  und
und  . Der Sandanteil in den Proben liegt in allen Jahren unter
. Der Sandanteil in den Proben liegt in allen Jahren unter  . Der Anteil an organischen Substanzen kann anhand des
Gewichtsverlustes der trockenen Sedimente beim Glühen bestimmt werden. In
[61] sind die Sedimentproben eine Stunde lang bei 1000°C geglüht
worden. Zudem ist der Kalkgehalt der Proben ermittelt worden, weil auch dieses
Mineral beim Glühen Gewicht verliert. Der Gehalt an organischer Substanz ist
dann rechnerisch aus Glühverlust und Kalkgehalt bestimmt worden. In den Proben
aus dem Lune-Watt liegt der Gewichtsanteil der organischen Substanzen im
trockenen Sediment bei
. Der Anteil an organischen Substanzen kann anhand des
Gewichtsverlustes der trockenen Sedimente beim Glühen bestimmt werden. In
[61] sind die Sedimentproben eine Stunde lang bei 1000°C geglüht
worden. Zudem ist der Kalkgehalt der Proben ermittelt worden, weil auch dieses
Mineral beim Glühen Gewicht verliert. Der Gehalt an organischer Substanz ist
dann rechnerisch aus Glühverlust und Kalkgehalt bestimmt worden. In den Proben
aus dem Lune-Watt liegt der Gewichtsanteil der organischen Substanzen im
trockenen Sediment bei  . Der organischen Substanz kommt beim
Transport kohäsiver Sedimente eine Bedeutung zu, weil sie zu einer
Verfestigung von Flocken und Boden ganz erheblich beiträgt [30] [124].
. Der organischen Substanz kommt beim
Transport kohäsiver Sedimente eine Bedeutung zu, weil sie zu einer
Verfestigung von Flocken und Boden ganz erheblich beiträgt [30] [124].
folgt: 5.2 Flockenbildung und Sinkgeschwindigkeit
hinauf: 5. Eigenschaften kohäsiver Sedimente
vorher: 5. Eigenschaften kohäsiver Sedimente
Jens WYRWA * 2003-11-05